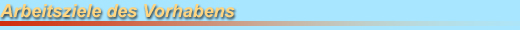Hydraulische Veränderungen
Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Dr. Weßling Beratende Ingenieure GmbH,
Universität Kiel
Eine abschließende Beurteilung des Leistungsvermögens der untersuchten Materialien im Feld kann nur erfolgen,
wenn eine genaue Erfassung der Strömungsgeschwindigkeit und Strömungsrichtung vorliegt.
Durch Verfeinerung des Messnetzes im näheren Umfeld der Reaktiven Wand und durch eine verbesserte Datengrundlage
mittels selbstregistrierender Pegel können die wirksamen hydraulischen Gradienten genauer erfasst und die
Strömungsrichtungen besser ermittelt werden. Durch eine Ausdehnung der Messreihen der bereits vorhandenen Pegel
können ggf. langfristige Veränderungen in den hydraulischen Eigenschaften der Reaktiven Wand durch Verschlammung,
Clogging, Sortiereffekte oder Präzipitatsbildung gemessen werden. Zusätzlich sind Tracerversuche für eine exakte
Erfassung und Berechnung von Strömungsgeschwindigkeiten vorgesehen.
Die zusätzlich erfassten hydraulischen Gegebenheiten und Variabilitäten gehen in die Erstellung eines
Grundwassermodells für das nähere Umfeld der Reaktiven Wand ein. Daneben sind die berechneten Durchflüsse die
Grundlage für Frachtenermittlungen und damit Stoffbilanzierungen für den Reaktionsraum.
Mikrobiologische Aktivitäten
Technische Universität Berlin, Universität Kiel
Aufgrund der bereits gewonnenen Erkenntnisse in Rheine ist davon auszugehen, dass innerhalb von drei Monaten
eine mikrobielle Adaption an die veränderten Milieubedingungen eingetreten ist. Die mikrobiologischen
Versuche werden mit Grundwasser aus Rheine und anaeroben Medium durchgeführt. Durch Vergleiche der beiden
Probendurchläufe vor und nach den Säulenversuchen sowie den Nullbeprobungen können qualitative Aussagen über
den Einfluss der Mikroorganismen in der Reaktiven Wand getroffen werden.
Reaktive Systeme mit elementarem Eisen stellen einen innovativen Ansatz zur in situ Reinigung von mit leichtflüchtigen
Chlorkohlenwasserstoffen (LCKW) kontaminierten Grundwässern dar. Aufgrund fehlender Untersuchungen und
Praxiserfahrungen betrifft der Haupt-Untersuchungsbedarf jedoch noch Ausmaß, Einflussfaktoren und Folgen der Entwicklung
von Wasserstoff durch die anaerobe Korrosion von elementarem Eisen im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit reaktiver
Systeme (Blockade durch Gasblasen). Für nahezu alle Organismengruppen anaerober Habitate stellt elementarer Wasserstoff
einen hervorragenden Elektronendonator dar. Somit ergibt sich aus der Entwicklung von Wasserstoff die Fragestellung, in
welchem Ausmaß ein mikrobiologischer Bewuchs zu erwarten ist. Grundsätzlich denkbare Effekte reichen dabei von einer
Blockade des reaktiven Systems durch das Zuwachsen mit Mikroorganismen bis hin zu einer gesteigerten Abbaurate von LCKW
durch synergistische Dechlorierungsprozesse. In diesem Projekt sollen erstmals die Existenz und das Potenzial von relevanten
Bakteriengruppen in der am Standort Rheine existierenden Wand mit elementarem Eisen erfasst werden. Im Einzelnen lassen sich
folgende, grundlegende Fragen formulieren:
- Gibt es eine messbare mikrobiologische Aktivität ?
- Welche relevanten ökophysiologischen Gruppen lassen sich nachweisen ?
- Sind reduktiv dechlorierende Bakterien vorhanden ?
- Wenn ja, haben diese Mikroorganismen einen positiven Effekt auf die Dechlorierungsrate ?
Ein Hauptziel dieses Forschungsvorhabens der Technischen Universität Berlin ist es also, den Einfluss von Mikroorganismen auf das Langzeitverhalten reaktiver
Systeme mit nullwertigem Eisen zu untersuchen. Dabei soll zum einen festgestellt werden, ob verschiedene, für bestimmte
Grundwässer typische Mikroorganismen fähig sind, elementares Eisen dauerhaft zu besiedeln und ob dadurch signifikante
Permeabilitätsverluste und Leistungseinbußen des reaktiven Systems entstehen. Zum anderen soll überprüft werden, ob und wie
die Dechlorierungscharakteristik eines reaktiven Systems mit elementarem Eisen durch verschiedene Mikroorganismengruppen
beeinflusst wird. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Nachweis der respiratorisch dechlorierenden Mikroorganismen gelegt,
da sich aus diesen Ergebnissen möglicherweise Alternativen für innovative Reinigungsverfahren ableiten lassen. Bei allen
Untersuchungszielen wird Wert auf die Übertragbarkeit der gewonnenen Ergebnisse auf andere Reinigungswände mit nullwertigem Eisen
gelegt.
Mit Hilfe dieser Untersuchungen kann die Bedeutung mikrobieller Einflüsse auf die Leistungsfähigkeit, Dechlorierungscharakteristik
und das Langzeitverhalten reaktiver Systeme mit elementarem Eisen beurteilt werden und ferner sollen sie einen Beitrag zur
Konzeption kombinierter mikrobiologischer/abiotischer Verfahren liefern.
In diesem Ansatz soll erstmals die Anwesenheit und das Aktivitätspotenzial sowie die dadurch zu erwartenden Auswirkungen von
relevanten Bakteriengruppen erfasst und bewertet werden. Untersuchungen dieser Art wurden bisher noch nicht durchgeführt, sind aber
unabdingbar, um das Langzeitverhalten von permeablen Reaktionssystemen besser prognostizieren zu können und schließlich damit auch
gegebenenfalls Vorbehalte gegenüber dieser Sanierungstechnologie zu beseitigen. Dabei stellt gerade die Möglichkeit, an der
Fe(0)-reaktiven Wand am Standort Rheine Untersuchungen durchzuführen, eine besondere Chance dar, weil dieses das in der Bundesrepublik
Deutschland am längsten betriebene, reale System im Feldmaßstab ist. Das erste Stadium der Alterung (Verwitterung) des Eisens im
kontaminierten Grundwasser ist bereits erreicht und damit auch die Möglichkeit der Ansiedlung von Mikroorganismen gegeben.